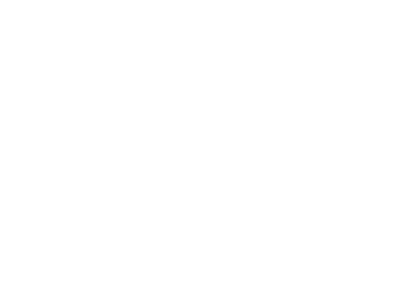Stefanie Krüger, 2008
Monika Czosnowska und Stefanie Krüger erhalten die Stipendien der ZF Kunststiftung 2008
geboren 1970 in Stuttgart; lebt und arbeitet in Stuttgart
Nachts im Park
Regina Michel im Gespräch mit Stefanie Krüger
RM: Anfang der Neunziger Jahre, als du dein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart begonnen hast, wurde immer wieder über das Ende der Malerei diskutiert. Stefanie, du hast dich von Anfang an für Malerei interessiert. Wie kam es bei dir zu dieser klaren Entscheidung?
SK: Das Medium, das mich als Ausdrucksmittel am meisten interessiert hat, war einfach die Malerei. Natürlich habe ich mich, wie andere Studenten auch – vor allem zu Beginn des Studiums Anfang der 90er Jahre – gefragt, ob Malerei noch ein zeitgemäßes Ausdrucksmittel ist, ob man überhaupt noch malen kann. Während meines Studiums an der Akademie habe ich dann auch mit Video experimentiert. Es war mir schnell klar, dass die Arbeitsweise und die glatte Bildschirmoberfläche nicht mein Fall waren. Natürlich haben Video und Installation ihre Berechtigung, aber ich brauche die Oberfläche des Bildes, das Haptische, das Sinnliche, das Material. Ölfarbe kann fließen, sie kann aber auch ganz zäh sein, man kann mit diesen Materialeigenschaften experimentieren, immer wieder Neues ausprobieren. Ich brauche den Malprozess, ich möchte mich über einen längeren Zeitraum mit einem Bild auseinandersetzen können.
RM: Welche Bedeutung hat der Faktor Zeit, den du da ansprichst, für deine Arbeit?
SK: Zeit ist ein ganz wesentlicher Faktor für meine Malerei. Meine Bilder brauchen Zeit. Das beginnt bereits bei der Malweise. Ich baue die Farben in meinen Arbeiten aus mehreren Farbschichten auf. Das gibt den Farben einen ganz besonderen Farbklang, eine ganz besondere Farbtiefe und ermöglicht so beispielsweise die dunkelgrünen differenzierten Nuancen der Schattenpartien. Diese Technik ist zeitaufwändig, da die einzelnen Farbschichten trocken sein müssen, bevor ich die nächsten darüber setzen kann. Deshalb arbeite ich meistens an mehreren Bildern gleichzeitig.
Ich brauche die Zeit aber auch, um mich intensiv mit einer neuen Arbeit auseinandersetzen zu können. Malen ist bei mir ein Prozess, in dem sich das Bild langsam entwickelt. Am Anfang steht eine Bildidee. Dann entstehen erste Skizzen. Versatzstücke aus Fotografien fließen ein, werden verändert, neu kombiniert, collagiert. Ich probiere aus, experimentiere. Erst wenn sich die Bildidee zu einer schlüssigen Komposition verdichtet, lege ich das Bild an und entwickle es dann immer weiter. Ich bin mir sicher, dass diese intensive Auseinandersetzung über einen längeren Zeitraum in meinen Arbeiten sichtbar ist.
RM: Wie findest du deine Motive?
SK: Viele Motive für meine Bilder begegnen mir im Alltag. Zum Beispiel die Liegende in der Arbeit Unipark. Als ich die Frau im Park gesehen habe, musste ich diese Situation im Foto festhalten. Es war so eigenartig, wie die Frau dalag, mitten auf der Wiese, einfach so, auf dem Rücken. Ich habe diese Situation dann in das Bild übernommen. Es sind verschiedene Assoziationen, die sich zu einer neuen Bildidee verdichten. Der Auslöser ist meist eine Situation, die mich berührt oder aber befremdet. Manchmal wecken solche Situationen auch Erinnerungen an ein bestimmtes Kunstwerk, das mich einmal sehr beeindruckt hat.
RM: Wer sind die Künstler, deren Arbeiten dich besonders berührt haben, die dich faszinieren?
SK: Ein Maler, der mir besonders gut gefällt, ist Félix Vallotton. Besonders seinen betont flächigen Stil, das Klare, Kühle, Distanzierte, seine Bildkompositionen mit den ungewöhnlichen Blickwinkeln und seinen Humor finde ich gut, aber auch die geheimnisvollen Stimmungen, die besondere Atmosphäre, diese gewisse Entrücktheit in den Bildern von Vallotton sind immer wieder Anregungen oder Inspirationen für meine eigenen Arbeiten, beispielsweise für Hafen mit Vollmond. Interessant finde ich auch den kanadischen Künstler Alex Colville. Bei ihm gefällt mir die detaillierte und genaue Darstellung, seine beherrschte Malweise, mit der er ganz alltägliche Szenen darstellt, die unterschwellig jedoch auch immer etwas Beunruhigendes oder vielleicht sogar etwas Magisches ausstrahlen.
RM: Immer wieder finden sich in deinen Bildern Parklandschaften und Gewässer: Seen, Flüsse, Brunnen und Schwimmbecken. Was ist es, was dich an Wasserflächen so sehr fasziniert?
SK: Das Motiv Wasser beschäftigt mich seit mindestens zehn Jahren. Ich komme immer wieder darauf zurück. Eine Wasserspiegelung sieht immer wieder anders aus, sie variiert nach Tageszeit, Lichteinfall oder Ort. Eine Wasseroberfläche kann spiegelblank sein, sie kann sich im Wind bewegen oder durch Wellen aufgewühlt sein, sie kann Laternen, den Mond aber auch dunkle Baumgruppen spiegeln. Das ermöglicht mir, Wasserspiegelungen immer wieder neu in Malerei zu übersetzen, mit Abstraktion, aber auch mit Materialien zu spielen. Ich kann das Flüssige im Material betonen und Farben ineinander laufen lassen wie bei Liegender am Wasserbecken. Ich kann aber auch die Abstraktion, die in einer Wasserspiegelung ja bereits angelegt ist, zu Gunsten einer ornamentalen oder abstrahierten Fläche herausarbeiten und so – wie in Menschen am Wasser oder Wasserspiegelung – die Flächigkeit des Bildes betonen.
RM: Du arbeitest immer wieder mit flächigen, abstrahierten Bildelementen. Gab es auch Ausflüge in die abstrakte Malerei?
SK: Ich habe nie wirklich abstrakt gemalt, das war kein Weg für mich. Aber ich habe schon sehr früh mit abstrakten Bildelementen experimentiert. Ich habe Formen, die an die abstrakten Expressionisten, etwa an Arbeiten von Ad Reinhardt erinnern, in meinen Bildern als Versatzstücke spielerisch mit Gegenständlichem kombiniert. In einigen Arbeiten habe ich ornamentale Elemente, die an Motive von Bridget Riley erinnern, als Hintergrund für Figuren verwendet. Dabei war es mir wichtig, verschiedenartige Bildelemente wie in einer Collage zu kombinieren. Bis heute interessiert mich die Verbindung von stark abstrahierten mit figürlichen Bildelementen. Die als Fläche interpretierten Wasserspiegelungen oder Rasenflächen setze ich dabei ganz bewusst ein, um die Tiefenräumlichkeit in meinen Bildern zurückzunehmen.
RM: Das Spiel mit der Wasserspiegelung lässt mich an das Motiv des Spiegels denken, der die Welt seitenverkehrt, manchmal sogar verzerrt, widerspiegelt.
SK: Die Wasserfläche als Spiegel … Die Wasserfläche ist für mich so etwas wie eine abstrahierende Fläche, sie spiegelt die Umgebung, durch die Bewegung auf der Wasserfläche entsteht, aber auch etwas ganz anderes. Das Abbild wird verzerrt, verfremdet, die Wasserspiegelung könnte auch etwas ganz anderes sein … Wasser als flüssiges Element im Gegensatz zum festen Boden ist vielleicht auch so etwas wie eine eigene Welt. Neben den formalen Aspekten fasziniert mich am Wasser sicherlich auch das Andere, etwas Fremdes, das irgendwie Beunruhigende.
RM: Das Fremde, das Andere, ich finde, diese Begriffe charakterisieren auch dein Werk recht gut. Wenn ich mich in die Arbeit Wasserspiegelung aus dem Jahr 2005 hineinversetze und mir vorstelle, ich würde dort am Ufer spazieren gehen, bekomme ich eine Gänsehaut, und nicht nur bei dieser Arbeit. Obwohl du ganz alltägliche Situationen malst, zeigen deine Arbeiten eine zugleich vertraute und doch auch ganz fremde Welt, eine Art Traumwelt, eine Vorstadtidylle, die jederzeit in einen Albtraum abgleiten könnte.
SK: Es sind oft nur ganz kleine Verschiebungen, minimale Abweichungen, die dieses Befremden hervorrufen. Die Wiese, die ich als leere Fläche darstelle, die extrem dunklen Schatten oder die ungewöhnlichen Perspektiven.
RM: Apropos Schatten, ich finde, gerade die ungewöhnlichen Lichtstimmungen verleihen deinen Arbeiten dieses Geheimnisvolle, Unheimliche. Das Licht in der Arbeit Kinderbecken erinnert mich an das schweflige Licht eines Gewitterhimmels.Es dämpft, verschluckt die Farbe der Sonnenschirme, während es das Blau des Pools zum Leuchten bringt. In anderen Arbeiten scheinen sich die Lichtverhältnisse zu widersprechen. Das Licht, das sich in Schwimmbad am Abend im Wasser spiegelt, erinnert mich an Mondlicht, obwohl der Himmel noch hell hinter der Baumgruppe leuchtet.
SK: Ja, das stimmt, Licht spielt eine wichtige Rolle in meinen Bildern. Ich arbeite oft mit ungewöhnlichen Lichtstimmungen. Ich habe das Schwimmbad an einem trüben, verregneten Sommermorgen entdeckt. Mir war sofort klar, das ist ein Motiv für mich: das menschenleere, verlassene Schwimmbecken, dieses fahle Licht, das die Farben der Sonnenschirme dämpfte, die Bäume im Hintergrund in dunkle Schatten tauchte, gleichzeitig aber das Becken in einem aggressiven Blau zum Leuchten brachte – das hatte etwas ganz Widersprüchliches, Unwirkliches. Dieser Bruch interessiert mich, wenn ganz alltägliche Orte plötzlich fremd, unwirklich werden, beispielsweise durch die besondere Lichtstimmung. Das findet sich auch in den Parkbildern. Obwohl sie eigentlich sonnig sind, sprechen die dunklen, undurchdringlichen Zonen, die tief verschatteten Baumgruppen im Hintergrund, mit, brechen die idyllische Stimmung.
RM: In Friedrichshafen hast du immer wieder Nachtbilder gemalt, die Spiegelung von Mondlicht und Lampen im See festgehalten. Ist das der Auftakt einer neuen Reihe?
SK: Ich hatte schon lange die Idee, Gewässer bei Nacht zu malen. Bereits in Stuttgart habe ich mich mit Wasserspiegelungen am Abend beschäftigt und habe in früheren Bildern auch mit Materialien wie Lack experimentiert. Am See hat es sich natürlich angeboten, die Idee für die Nachtbilder umzusetzen. Zudem gibt es von Adam Elsheimer ein berühmtes Nachtbild mit der Milchstraße, Flucht nach Ägypten, das mir sehr gut gefällt – die Stille, die poetische Lichtstimmung, das Dunkle. Die Vorliebe für dieses Bild und meine persönlichen Beobachtungen haben dann dazu geführt, dass ich mich in Friedrichshafen intensiv mit Nachtbildern beschäftigt habe.
RM: Welche Intention verfolgst du mit deinen Arbeiten? Haben deine Bilder eine Botschaft?
SK: Ich kann und möchte meine Bildideen nicht ausformulieren und bis ins Detail interpretieren. Vermutlich liegt es daran, dass immer auch das Unbewusste am Bildprozess beteiligt ist. Ich sehe etwas, ich fotografiere, ich male und ich spüre, wenn das Bild in sich stimmig ist, wenn es die Stimmung und die Atmosphäre ausstrahlt, die mich interessiert. Ob ein Bild spricht, und was es möglicherweise zu sagen hat, kann nur der einzelnen Betrachter beantworten.
Sehgänge
Clemens Ottnad
Immer wieder Wasser, ihr Schimmern, Glänzen, Durchsichtigsein. Die Orte sind vertraut: See, Schwimmbad, Teich, Bassin. Stefanie Krüger erforscht in ihren Arbeiten vielfach Gewässeroberflächen, mal inmitten der Ursprünglichkeit der Naturlandschaft, mal im urbanen Umfeld von Stadtarchitekturen, als Dünung sacht bewegte, oder aber reglos spiegelnde. Dabei bannt sie die Flüchtigkeit momentaner Seherfahrungen in langwierigen, Schicht um Schicht anlagernden Malprozessen, sodass sich spätestens in unmittelbarer Nahsicht vermeintlich so Leichtes, Durchscheinendes verfestigt in sukzessiv aufgebaute Malmaterie, die offensichtlich einen verdichteten Farbenschmelz ausbildet, der glauben zu machen vermag, allerorten hydrogene Territorien seien vielleicht auch in der Wirklichkeit schadlos – trocken und ohne gemeinhin drohenden Untergang – zu beschreiten.
Eben noch befangen in der Anmaßung, solcherart übers Wasser gehen zu wollen, findet sich allerdings der Betrachter der Gemälde nicht nur mit der Untiefe multipler Farbschichten sowie der Leinwand selbst konfrontiert, sondern stürzt schon in größerer Entfernung von den Bildwerken kopfüber in gefahrvolle Untiefen der aufgesuchten Vorstellungswelten. Mit ebendiesen unentrinnbar konfrontiert, nimmt er zunächst bereitwillig an, die Spielstätten bereits zu kennen, in die jäh hineinversetzt er sich auf einer Schaubühne des Alltäglichen wiederfindet; ohne Handlungsanweisungen ratlos, muss er sich aber vor menschenleerer Kulisse nach Mitakteuren umsehen, denen er hier – im Park, im Bad, am Hafen – zu begegnen doch stets gewohnt war: Sie fehlen. Am ortlosen Ort sind sie abwesend (mit anderen anderswo), die Zeit angehalten, also Unzeit, der stillgelegte Zeitpfeil markiert ein just Vergangenes und das im nächsten Augenblick erst noch Geschehende gleichermaßen.
Standpunktbestimmung: Schwimmbeckenlackblau hell draußen, den Großteil des Bildgrundes vereinnahmend, in zwielichte Tageszeiten (zu früh, zu spät?) getaucht, zum Darstellungsrand unten das Reservoir mit der leicht wellend gemalten Oberfläche ausgebreitet, nach hinten sich dasselbe verjüngend, dem Bildgegenüber in breiter Front schier entgegenfließend, an der Stirnseite die reptil gewundene Kinderrutsche in Tiergestalt, das lichtere Blau gerahmt, und dieses umfangen von der hellgrün weich bewachsenen Wiesenfläche, dunkleres Waldgrün dagegen, eine undurchdringlich oft abschirmende Wand aus Vegetation: Stereotypen alltäglicher Wirklichkeitserfahrungen und merkwürdig stille Mysterien zugleich.
Indem nämlich Naturphänomene, Lichtsituationen, Baukörper, Oberflächen und Strukturen in präzisester Malweise so eindringlich und detailliert geschildert die Stofflichkeit des Gezeigten wiedergeben, empfindet der Betrachter ein irgend geheimes Unbehagen ausgerechnet an dem in der Darstellung Abwesenden und doch gleichzeitig bereits selbst schon unwillkürlich Mitgedachten. Erinnerungen, Ahnen und Vermuten, Empfindensanalogien von Künstlerin und den diese Arbeiten Betrachtenden überschneiden sich. Denn über individuell je verschiedene biografische Erfahrungshintergründe und Sinnenkategorien hinweg rührt allein schon der gewählte Farbton des Schwimmbeckens an seit Kinderzeiten eingeprägte Vorfreuden etwa auf schul- und arbeitsfreie Freibadtage, die endlos langen Sommerferien, das selbst- und zeitvergessene (Aus)Gelassensein.
Dieses Fernbleiben und die Abwesenheiten in namenlosen Niemandslanden, die von menschlichen Figuren so verlassenen Orte, (ver)führen hier allerdings unversehens in viel umfassendere malerische Synästhesieapparate weiter. Schon verströmt da selbstsinnig die gesetzte Ölfarbe sinnenübergreifend den badeanstaltstypischen Chlorgeruch, brennen die heißen Steinplatten und Kacheln an nackten Fußsohlen, bevor ganz vorsichtig von aluminischen Leitertritten und Handläufen aus Zehenspitzen die Temperatur des Wasserbeckens zu bemessen versuchen, oder aber ganz Waghalsige sich – wie gewohnt an diesen Orten verbotenerweise – übermütig Kopf voran ins kühlende Nass zu stürzen anschicken, überall Spritzer, Tropfen, Lachen, bizarre Rinnsale hinterlassend, die als sich verselbständigende Malwerke gerinnen zu amorphen Fleckenbildungen und eigenwilliger Ornamentik.
Die Schilderungen von Stefanie Krüger bleiben zwar dauerhaft entvölkert, Bildgrund und Malmittel – dem Ausdrucksmedium ja entsprechend – auch immer noch vollständig stumm, mithin ist allerdings sehr wohl ein Glucksen und Gurgeln an den Überläufen mitgehört, das Platschen, Prusten, Schnauben, Kinderschreien, und alles übergehend in ein Grundrauschen – Bildrauschen auch – einer allerorten, jederzeit und zugleich doch individuell erfahrbaren Alltagswirklichkeit.
Angesichts des mit den Mitteln jener Malerei festgelegten Stillstandes, des wie eingefroren wirkenden Augenblicks erstaunt aber umso mehr, dass inmitten dieser Ort- und Zeitlosigkeit nachgerade stereotype Handlungsabläufe situativer Alltagsstandards evoziert werden. Mit dem bloßen Abbild nämlich des Schauplatzes – hier des öffentlichen Bades – stellen sich ebenso offiziell verordnete wie über Lebenszeit allmählich angeeignete Grundmuster menschlicher Verhaltensweisen, Regeln und Rituale ein, die mehr oder weniger allgemein verbindlich oder jeweils persönlich ausgeprägt erscheinen: entkleiden, umziehen, Kleidungsstücke zusammenlegen, duschen, Haare waschen, Augenbrennen, abtrocknen, desinfizieren, barfuss gehen (und sich dabei nicht an scharfen Kanten schneiden oder schmerzhaft anstoßen), kraulen, untertauchen, auf dem Rücken schwimmen, anderen Schwimmern ausweichen, Mitschwimmern genügend Raum lassen, mit den Armen rudern, Kreise ziehen, gleichmäßig atmen, am Bahnende wieder wenden, hinaus schwimmen zur Seemitte, der Kopf zu einem schwarzen Punkt verschwindend, die triefenden Gesichter, Haare, Badehauben, die Person schier unkenntlich gemacht – und zurück, an Land, mit festem Boden unter den Füßen die selben schematisch einstudierten Abläufe in umgekehrter Reihenfolge wieder zurückzuspulen, gleich Wiederholungen von filmischen Sequenzen.
Besonders das Element Wasser, die Momente des Fließens und Zerfließens allgemein beherrschen motivisch die aktuellen Arbeiten von Stefanie Krüger. Im Gegensatz zu natürlichen oder wenigstens naturnahen See- und Meereslandschaften handelt es sich vorzugsweise allerdings um von Menschenhand angelegte Architekturen, wie Hafenanlagen, Schwimmbäder oder städtebauliche Park- und Platzgestaltungen (das Sujet der Tankstelle noch Umschlagplatz von Flüssigkeiten).
Gleichwohl tauchen in vielen der Darstellungen menschliche Figuren nur eben so am Rande auf, scheinen eher die Proportionen der gezeigten Areale veranschaulichen zu wollen oder als zusätzliche Bewegungsmotive zu dienen. Und als ob sich selbst diese noch widersetzen wollten, die Bildkomposition als belebte zu kennzeichnen, fügt sie die Künstlerin oft genug als Schlafende, Ruhende und Liegende – beispielsweise in den Parkansichten – ein. Spaziergänger sind es bestenfalls, die sich – dem Auftrag ihres flüchtigen Passantentums bewusst und damit in Analogien zum temporären Betrachter auch des Dargestellten – umgehend anzuschicken wissen, das Bildgelände schleunigst auch wieder zu verlassen. Gegenüber den preziös schillernden Wellenformen und augenschimmernd vibrierenden Unschärfen der Wasserspiegelungen jedenfalls erscheinen sie – mindestens im Vergleich zur übrigen Oberflächenbehandlung der Malerin von Natur- und Dingwelt – als wenig ausdifferenzierte, fast farblos anonymisierte Unpersonen eines zwangsläufigen Vorübergehenmüssens.
Essentiell bleiben somit Naturerscheinungen und Gegenstandswelt zurück, die unabhängig von einzelner Individuität und eigenem Tun – und über dieselben auch hinaus und fortdauernd – eine vom Menschen abgelöste, selbständige Existenz für sich zu behaupten wissen. Indem die Bilderfinderin die eigene Persönlichkeit und ein irgendwie Privates der wiedergegebenen Orte, Lebensräume und Figuren fast gänzlich zurückdrängt, scheint sie den dieselben Betrachtenden im gleichen Maße den Zutritt zu einer freilich nur bedingt wirtlichen Bildwelt verschaffen zu wollen. Das je Andere – persönliches Wesen und Biografie der Rezipienten etwa – wäre in deren farbgeflutetem Horror Vacui (gemeinsam mit dem skeptischen Beargwöhnen von Realien von Seiten der Künstlerin) in Frage gestellt. Notgedrungen beschliche auch sie gewiss die Vorahnung, von den so gezeigten Umgebungsräumen – von dickichten Unter- und Hintergründen, von den Dingen, vom schon genannten allumfassenden (Über)Fließen – aufgesogen und in diesem Unwirklich-Wirklichen vollständig verschwinden gemacht zu werden. Vertraulichkeiten sind da dem dieserart allenthalben so vertraut Erscheinenden alltäglich erfahrbarer Realität und der vorderhand realistischen bildnerischen Wiedergabe des Realen in jedem Falle fremd.
Gerade mit den Dämmerlichtsituationen und nächtlichen Szenen – Hafen mit Vollmond und den weiteren in diesem Zusammenhang entstandenen Nachtdarstellungen – entwickelt Stefanie Krüger die Konzentration auf Farbe und Licht bei gleichzeitiger Reduzierung überflüssigen Bildinventars weiter. Mondlicht, die Positionslampen der Anlegestelle, diffuses Scheinen natürlicher wie künstlich verursachter Lichthöfe, mäandernde Farbverläufe von Wellen und Wolken, schlierig einander auch widerspiegelnd, vermitteln schemenhafte Eindrücke des (mit Ortskenntnis allerdings erst versehen) geografisch konkret bezeichenbaren Ortes. Wiewohl die Hauptprotagonisten des Fährhafens – Schiffe und beförderungswillige Passagiere – gänzlich fehlen, ruft das menschenverlassene Tor in die Dunkelheit melancholierende Erinnerungen an vergangene wie zugleich auch Erwartungen an zukünftig anzubrechende Tage, fortwährende Überfahrten und Seitenwechsel hervor. Bar jeglichen narrativen Instrumentariums berichtet die Malerin hier dennoch ganz selbstverständlich und mit (im Wortsinn) ungeheurer Suggestionskraft vom – zugegebenermaßen vorübergehend unsichtbaren – Ankommen und Verlassen von Orten wie von Menschen, der Geschäftigkeit der Reisenden und Angestellten im aquaren Arbeitsalltag, von mechanischen Manövern und stetiger Mobilität, indem sie ausgerechnet deren somnambules Stillstehen beschreibt.
Wasser, Wolken und Gestirne, wie auch technische Leuchtvorrichtungen geraten da zum eigentlichen Anlass des Malens, zum bloßen Vorwand, Farbe, Licht, Räumlichkeit intensiv nachzuspüren und deren gegenseitige visuelle Einflussnahmen und Wechselwirkungen zu untersuchen. Blendete man bei einigen der Arbeiten von Stefanie Krüger nur einen geringfügigen Teil der Bildkomposition aus, beispielsweise die häufig hoch angesetzten Horizontpartien, bauliche Detailformen, das singuläre Personal, auch medial typisierte Naturchiffren und Pflanzenstrukturen, so blieben in sich dynamisierte, völlig gegenstandslose Farbareale zurück, die ausschließlich vermittels ihrer Leuchtkraft, den darin enthaltenen Lichtführungen und eingeschriebenen Bewegungspotenzialen wirkten.
Wenn schließlich öffentliche Orte in diesen Arbeiten der Öffentlichkeit offenkundig beraubt wirken müssen, vielleicht auf Zufallsfunde im Vorübergehen rekurrieren und diese sich konsequent einem privat Persönlichen zu entziehen bestrebt sind, so vergewissert sich die Künstlerin doch der Weltwirklichkeit im besonderen Maße über eine bemerkenswert ausgeprägte Wahrnehmungsgabe und deren nachfolgend brillianter Übertragung in Malerei. Noch in den vorgenannten Abwesenheiten spiegeln gerade die gleichsam kostbar schimmernden Oberflächen des Als-ob-beiläufig-Gesehenen unsichtbare Augenblicksaufnahmen der Autorin (als Selbstbilder in absentia) wider, deren gegenwärtige Momenthaftigkeit in metaphysische Malzeit hinein gedehnt erscheint, von/m Anderen geklärt, sowohl individuelles Grundbedeuten als auch Gemeingültigkeit von Wahrnehmung und Empfinden erhalten. Das Erwarten sind bei Stefanie Krüger Great Expectations! zwischen Ahnungen des Wirklichen und einem anderen unbewussten Geheimen, das gegen Wirklichkeiten anscheinen kann.